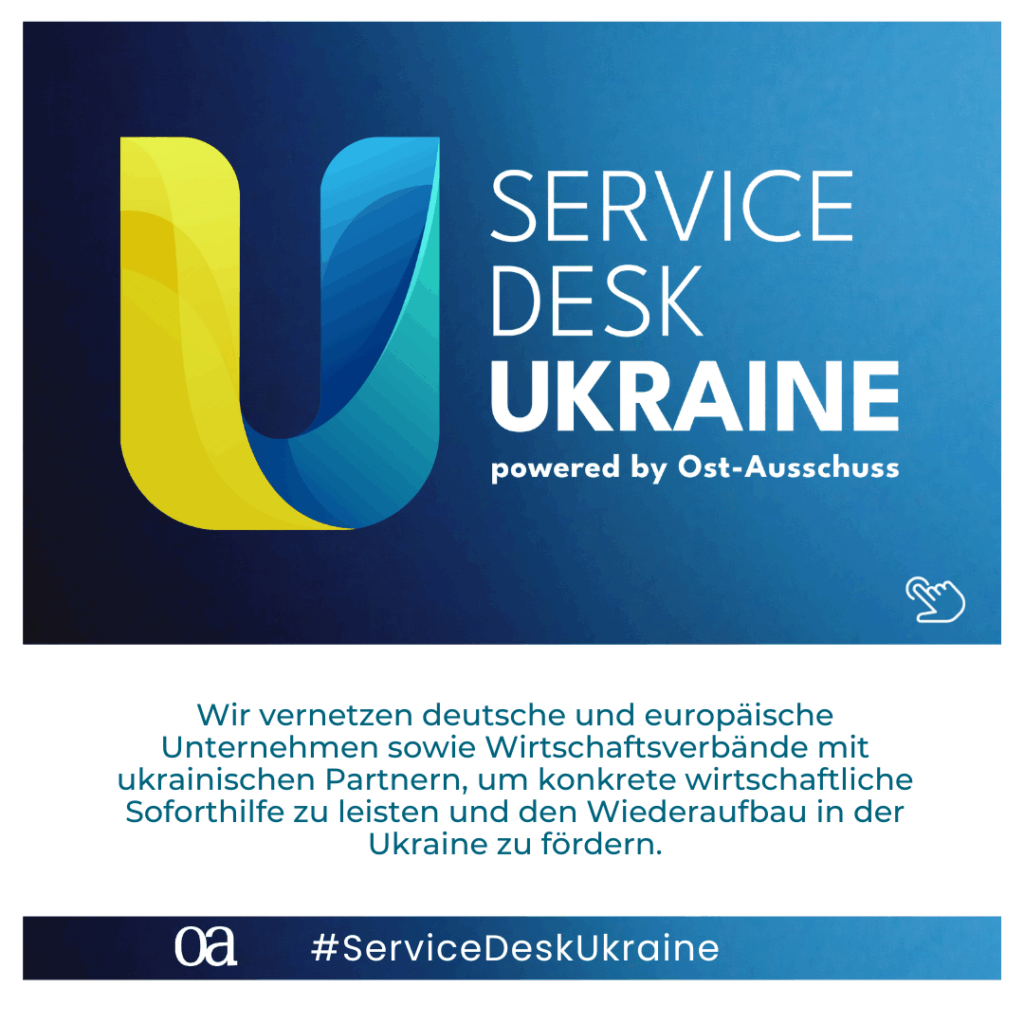Ost-Ausschuss-Delegation informierte sich in Warschau über die polnische Energiewende
Polens himmelwärts strebende Hauptstadt Warschau zeigte sich drei Tage lang von ihrer Sonnenseite, als eine Ost-Ausschuss-Delegation mit rund deutschen 30 Unternehmensvertreterinnen und -vertretern Anfang April die Perspektiven der grünen Transformation im Nachbarland erkundete. Polen hat ambitionierte Pläne, um von der dominierenden Kohle loszukommen und nicht weiter das „schwarze Herz Europas“ zu sein. Dazu gehören der Bau großer Offshore-Windparks in der Ostsee, aber auch Solarenergie, Wasserstoff, Biomethan und Atomkraft.
Die Teilnehmenden konnten in zahlreichen Gesprächen mit Staatssekretär Krzysztof Bolesta im Ministerium für Klima und Umwelt, der deutschen Botschaft in Warschau, der AHK Polen, der polnischen Investitionsagentur PAIH, bei CMS Polska und bei der polnischen E.ON-Tochter viele nützliche Informationen sammeln, Fragen stellen und untereinander Geschäfte anbahnen. Angeführt wurde die Gruppe von Tosten Weber, Geschäftsführer von Remondis International und Schirmherr der Unternehmensplattform Grüne Transformation im Ost-Ausschuss, die den Besuch gemeinsam mit dem Arbeitskreis Mittelosteuropa organisierte.
Polen wird immer wichtiger
Der Zeitpunkt des Besuchs war nicht nur wegen des Wetters mehr als günstig gewählt. Seit vergangenem Jahr ist Polen, ohnehin der mit Abstand wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands in der Ost-Ausschuss-Region, für deutsche Unternehmen vor China der viertgrößte Absatzmarkt weltweit. Seit Jahresbeginn hat das Land die EU-Ratspräsidentschaft inne und gestaltet damit auch die europäische Klima- und Energiepolitik mit. Zudem widmete die künftige Bundesregierung im Koalitionsvertrag dem Nachbarn besondere Aufmerksamkeit. Insbesondere strebt die künftige Koalition eine Aufwertung des so genannten Weimarer Dreiecks mit Polen und Frankreich an.
Dass die politische Vernachlässigung des wichtigsten deutschen Partners im Osten seit dem Warschauer Regierungswechsel zu Frustrationen geführt hat, war in vielen Gesprächen spürbar. „Von deutscher Seite ist immer die Extrameile notwendig, um Vertrauen zu schaffen“, hieß es beim Briefing der Teilnehmenden zum Auftakt des Besuchs.
Ein Neustart im deutsch-polnischen Verhältnis tut not, dazu gehört auch eine enge Kooperation in der Energie- und Klimapolitik, auch wenn Weg und Ziele in den beiden Nachbarländern durchaus unterschiedlich sind. Anders als Deutschland setzt Polen bei der Energiewende u.a. auf Atomkraft. Die Probleme – mangelnder Netzausbau, fehlende Speicherkapazitäten und unsteter grüner Strom – sind dagegen die gleichen.
Dekarbonisierung im Kohleland
Klar ist: Polen will und muss sich dekarbonisieren. Der Nachholbedarf ist groß. Noch liegt der Anteil der Kohle im Energiemix bei rund 70 Prozent, bis 2040 soll er auf laut dem polnischen Klimaschutzplan fast auf null heruntergefahren werden. Windkraft soll dann 55 Prozent beisteuern, Solarenergie 20 Prozent und Atomkraft 14 Prozent.
Dies alles wird viel Geld erfordern, das auch aus EU-Mitteln kommen soll. Bis 2040 will die Regierung allein im Stromsektor fast 250 Milliarden Euro in die Erzeugung und den Netzausbau investieren. Die Regierung Tusk hat die Energiewende zu einem wichtigen Teil ihres Wirtschaftsprogramms gemacht, aber. Zugleich werden aber Klimaziele angepasst, die Wasserstoffstrategie von 2022 überarbeitet und Flottenquoten etwa für Elektroautos gesenkt. Ein Erneuerbare-Energien-Gesetz steht noch aus – Wiedervorlage nach den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Mai.
Die Unternehmen machen Tempo. „Die Wirtschaft treibt die grüne Transformation voran, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte AHK-Chef Lars Gutheil, der den Teilnehmenden zu Beginn einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen gab. Die Unternehmen sehen Nachhaltigkeit eher als Wettbewerbsvorteil, auch wegen entsprechender Erwartungen von Kunden und Investoren. Zudem erhoffen sie sich von mehr grüner Energie im Netz niedrigere Strompreise.
Energiemix wird bunter
In seiner Dekarbonisierungsstrategie setzt Polen auf Windkraft, Solarenergie, Wasserstoff und eben Atomkraft, die hier weit weniger umstritten ist als in Deutschland. Erdgas gilt nach Angaben von Germany Trade und Invest (GTAI) als Übergangstechnologie. Bei der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung sollen Biomasse und -methan, Wasserstoff und der Einsatz von Wärmepumpen eine große Rolle spielen. Deutsche Wärmepumpenhersteller haben im Land investiert. Polen kann bei seiner Energiewende auf das größte Fernwärmenetz Europas bauen, an das über die Hälfte der polnischen Haushalte und Unternehmen angeschlossen sind.
Vor Polens Ostseeküste haben Planung, Ausschreibung und Bau mehrerer großer Offshore Windparks begonnen, die in zwei Phasen bis 2030 und 2040 errichtet werden sollen. Die ersten Windräder in der Ostsee sollen sich 2026 drehen, derzeit wird vor Gdynia für die Fundamente gebohrt, was durch die geringe Tiefe dort erleichtert wird. Am Windpark FEW Baltic II mit 0,35 Gigawatt Leistung ist der deutsche Energieriese RWE beteiligt. Die Produktion von Windkraftanlagen wird dabei staatlich gefördert. Deutsche Unternehmen aus dem Logistik- und Energiesektor hoffen auf Aufträge als Zulieferer oder Subunternehmer. Die geplanten Investitionen von 70 Milliarden Euro in die Offshore-Windparks sind laut Dominika Taranko vom internationalen polnischen Wind Industry Hub „das größte polnische Investitionsprogramm“. Erneuerbare Energien hätten endlich die politische Unterstützung, die lange gefehlt habe.
Mit amerikanischer Technologie will Polen aber auch ein Atomkraftwerk bei Gdańsk bauen. Ein weiteres Kernkraftwerk ist geplant. Schon die projizierten Kosten für den ersten der beiden geplanten Standorte belaufen sich auf über 30 Milliarden Euro.
Wasserstoff soll ähnlich wie in Deutschland vor allem als alternativer Energieträger in bestimmten Industrieprozessen, wie der Metallproduktion, und in Sektoren zum Einsatz kommen, die sich anders schwer dekarbonisieren lassen. Beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft zeigt man sich aber selbst im Ministerium für Energie und Klimaschutz, das in grüner Hand ist, abwarten. Polen beobachtet, wie sich die Wasserstoffwirtschaft im Rest Europas entwickelt.
Nadelöhr Stromnetz
Das große Nadelöhr der polnischen Energiewende ist nach Einschätzung der GTAI und anderer Experten das Stromnetz. Es ist veraltet und kann nur sehr begrenzt neue dezentrale Kapazitäten aufnehmen. Dank EU-Geldern führen die Netzbetreiber aktuell mehrere milliardenschwere Modernisierungsprojekte durch. Der Anteil der Erneuerbaren Energien in Polens Strommix hat sich in den letzten fünf Jahren immerhin auf über ein Fünftel erhöht. Das führt dazu, dass an sonnigen und windigen Tagen zu viel Strom im Netz ist und Anlagen abgeschaltet werden müssen. Milliardenschwere Investitionen in Energiespeicher sind erforderlich, um die Stromüberproduktion zu speichern und während der Dunkelflaute wieder ins Netz abzugeben. Die Regierung hat zuletzt größere Fördermittel im Bereich Stromspeicher angekündigt.
Für das östliche Nachbarland ist die Sicherheit der Energieversorgung ein Standortvorteil, mit dem man Investoren locken will. Anders als Deutschland hat Polen frühzeitig in LNG-Terminals in Swinoujscie und Gdansk (Inbetriebnahme 2027) investiert, und wird über die Baltic Pipe mit Gas aus Norwegen beliefert, das auch an die südlichen Nachbarn geliefert werden kann. Im deutschen Hafen Mukran in Saßnitz wurden dafür Komponenten zugeliefert, jetzt hofft man auf Rügen an eine Belieferung der Offshore-Windparks.
Überblick über den Dächern von Warschau
Hoch über den Dächern von Warschau gaben Vertreter der Energieabteilung und der German Business Group der Rechtsanwaltskanzlei CMS Poland den Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für die grüne Transformation in Polen vom Netzausbau bis zu CSR-Direktiven. Ziel des polnischen Gesetzgebers ist es generell, mehr Anreize für die polnische Energiewende zu setzen und deren Umsetzung zu beschleunigen. Insbesondere der Netzausbau soll verbessert und beschleunigt werden. Benötigt werden wie in Deutschland Verbindungen von den Offshore-Windparks und AKWs nach Süden. Laut des neuen Gesetzes zur flexiblen Netzanbindung (GCA) sind zum Schutz vor Überlastungen zeitweilige Einschränkungen beim Netzzugang durch den Betreiber) möglich.
Wie ein deutsches Energieunternehmen auf dem polnischen Markt agiert, konnten die Teilnehmenden zum Abschluss bei der polnischen Tochter von E.ON erfahren, die mit verschiedenen Sparten in Polen unterwegs ist und in Warschau über eine Millionen Kunden mit Strom und Wärme versorgt. Dazu tragen stadtweit etwa 60 Verteilerstationen bei, von denen die Ost-Ausschuss-Delegation eine in Augenschein nehmen konnte.
Insgesamt bot die Reise den teilnehmenden Branchenvertreterinnen und-vertretern viele Anknüpfungspunkte. Vielleicht werden Deutschland und Polen in Zukunft ja trotz unterschiedlicher Transformationspfade das grüne Doppelherz Europas bilden.
Christian Himmighoffen
Leiter Presse und Kommunikation